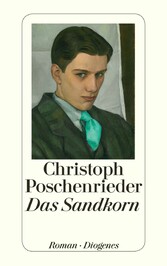Suchen und Finden
[22] Der Auftrag
Rom, Königlich Preußisches Historisches Institut, Mai 1914
Es ist kein großartiger, doch immerhin: es ist ein Posten in Rom, der schönsten Stadt auf Erden; in der man dem Himmel am nächsten ist, was ein jeder spürt, der einmal unter der Kuppel, dieser mächtigen Saugglocke, gestanden und himmelwärts geschaut und das Gefühl gehabt hat, nach oben zu schweben: So ergeht es jedenfalls Jacob Tolmeyn jedes Mal, wenn er den Petersdom besucht.
Dass er ganz unten anfängt, als Dritter Sekretär (auf Probe) am Königlich Preußischen Historischen Institut, merkt Tolmeyn schon bei der Zuteilung seines Arbeitsraums. Dieser liegt im Souterrain günstig zum Handarchiv; weniger vornehm ausgedrückt: ein Kellerloch. Was zwar Wege erspart (ständig hat er Dokumente hin und her zu tragen), ihm aber das Gefühl der Abgeschiedenheit, sogar Gefangenschaft vermittelt; obwohl durch das hoch in der Wand eingesetzte, in einen Schacht versenkte Fenster ab und zu eine Lichtspiegelung, ein Luftstoß und ein Klang von der Straße hereinfällt; eher zufällig, wie kleine Pelztiere, die in eine Falle getappt sind und noch ein Weilchen zappeln, bis die Ruhe wieder einkehrt.
Es hätte ihn nicht gewundert, wenn seine Uhr jeden [23] Morgen um acht Uhr stehengeblieben wäre, denn wenn er am Ende seines Arbeitstages aus dem Keller aufsteigt, zeigt sie wieder, oder immer noch, auf die acht. Tolmeyn gleicht die Zeitangabe kurz mit der Wanduhr über dem Portal des Palazzo Giustiniani ab, bevor er die von der Gegenwart bestimmte Hälfte seines Lebens in der vis-à-vis gelegenen Kneipe mit einem Aperitivo und einer Gier und Leidenschaft beginnt, für die ihn seine Jahre in Berlin gut vorbereitet haben.
Die andere Hälfte besteht aus Mittelalter, leider viel zu selten dem leuchtenden, dem bunten Mittelalter, wie man es aus farbig ausgemalten Handschriften kennt. Meistens handelt es sich um staubige Abschriften von Urkunden, die man oben, im zweiten Stockwerk, für wichtig hält.
Institutsdirektor Professor Stammschröer ist besessen von Diplomatik, der Urkundenlehre. In allen bedeutenden Archiven der italienischen Halbinsel lässt er nach »Kaiserurkunden und Reichssachen» fischen. Wobei es ihm um deutsche Kaiser und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation geht; nichts sonst; jeglicher Beifang wird wieder in den Ozean gekippt. Es ist die Aufgabe Tolmeyns, die reichlich hereinströmenden Erkenntnisse zusammenzufassen, nach vorgegebenem Stichwortraster aufzubereiten und nach oben zu reichen. Zurück erhält er in der Regel bloß dürre Zettelchen der Belobigung, des Tadels und der weitergehenden Instruktion.
Deshalb wundert er sich, als Anfang Mai Professor Stammschröer höchstpersönlich erscheint. Umstandslos räumt dieser ein paar Dokumentenbündel von dem für Besucher vorgesehenen Stuhl. Er setzt sich aber nicht, als er die Staubwolken aufsteigen sieht, und sagt im Ton einer Feststellung:
[24] »Tolmeyn, können Sie umgehend reisefertig sein?«
»Wohin, Herr Professor?«, fragt Tolmeyn.
Umgehende Reisefertigkeit scheint doch vom Reiseziel abzuhängen. Einen Spaziergang nach Ostia, den bewerkstelligt er natürlich aus dem Stand, mit einem Griff nach dem Hut.
Stammschröer lockert seinen Zwicker mit einem Nasenkräuseln und lässt ihn – am Faden gesichert – abstürzen. Gegenfragen hat er gar nicht gern. Wenn er seinen Dritten Sekretär auf die Suche nach Livingstone hätte schicken wollen, hätte er ihm sicher eine längere Vorwarnung gegeben.
»Gehen Sie sofort nach Hause packen, dann erreichen Sie noch den Express nach Neapel. Umsteigen in Caserta, Foggia, Barletta. Dort die Dampf-Tramway. Morgen Vormittag spätestens müssen Sie in Andria sein. Unser rasches Eingreifen ist erfordert.« Zum letzten Satz schießt der Zeigefinger in die Höhe.
Professor Fridolin Stammschröer: ein Mann so groß wie breit wie imposant. Gegen Selbstzweifel imprägniert wie der Kleppermantel gegen Regen. Tolmeyn hat ihn nur drei- oder viermal gesehen in den sieben Wochen, die er nun in Rom arbeitet, aber schon zu Berliner Zeiten von ihm gehört. Der Mann ist eine Koryphäe. Er zählte zwar nicht zu den ersten Gelehrten, die nach der Öffnung des vatikanischen Geheimarchivs 1881 aus aller Welt herangetappt kamen wie die Bären, um endlich, endlich, ihre Pratzen bis zu den Schultern in dem so entsetzlich lange unerreichbaren Honigtopf zu versenken. Aber Stammschröer, kurz danach erstmals in Rom gewesen, hatte sich verliebt (in die Stadt ein wenig und geradezu närrisch in ihre unerschöpflichen Vorräte an Urkunden) und geschworen, wiederzukommen. Zur [25] Ausbeutung des vatikanischen Archivs war das Institut gegründet worden. Zur Gelehrtheit kam bei Stammschröer noch ein Quantum Raffinesse: Er verhalf zunächst einem befreundeten Professor in den Sattel des Institutsdirektors, nur um diesen alsbald zu beerben. So hat es Tolmeyn jedenfalls erzählt bekommen von seinem Schweizer Kollegen, der im benachbarten Kellerkabuff schon eine Weile länger Urkunden sortiert.
Nun umzirkelt ihn der Professor, als wolle er ihn sogleich mit seiner breiten weißen Hemdbrust aus dem Raum drücken, derselben strahlenden Hemdbrust, mit der er, wie mit einem Keil, jeden Morgen die Menschenmengen in Gassen und auf Plätzen teilt, wenn er sich in kerzengerader Haltung bei akkurat gezieltem Stockeinsatz (die stählerne Spitze bohrt er gerne in Papiere, Essensreste und anderen Unrat) auf den Palazzo Giustiniani zubewegt: ein schneidiger Kürassier des Geistes, Ulan der Forschung, Dragoner der Neugier. Tolmeyns Kollege hatte ihm bald geflüstert, was die Straßenkinder dem Professor nachrufen; frech und ordinär und anspielend auf einen zweiten Stock, den man dem Professor, nun – von unten her eingeschoben hat, zwecks Erzielung dieser makellos gereckten Statur. Tolmeyn denkt gerade daran, behält aber den ernst-beflissenen Gesichtsausdruck und tritt zur Seite.
Stammschröer schiebt ein paar Urkunden auf dem Schreibtisch zusammen.
»Das hat sechshundert Jahre ungelesen herumgelegen, da kommt es auf fünf Tage auch nicht an. Nur zu, Doktor Tolmeyn, ich setze Sie auf dem Weg nach oben ins Bild.«
Das Bild gleicht einer Klage.
[26] Ach!, die Kollegen vom sehr verehrten Kulturgüterministerium dort unten. Allzu schnell bei Spitzhacke und Schaufel, wo es der Pinzette und eines feinmaschigen Siebes bedürfe. Beste Absichten, aber es fehle ihnen an Geduld, Information und – nun ja: Anleitung.
»Aber sprechen Sie das um Gottes willen nicht aus: Wir helfen, natürlich. Und das gerne.«
Er habe, sagt Stammschröer auf der Treppe, Witterung bekommen von einer unmittelbar bevorstehenden Aktion des Bürgermeisters von Andria, Vito Sgarra, der die Krypta des Doms zu Andria ausräumen lassen wolle.
»Sie wissen doch, was man dort vermutet«, sagt Stammschröer wieder im Ton der Feststellung.
»Andria, ah ja –«, sagt Tolmeyn, nur ungefähr über diesen kunstgeschichtlich eher zweitrangigen Dom unterrichtet, aber auf das mitteilende Naturell des Professors vertrauend.
»Ganz genau, die Kaiserinnengräber. Bitte, von mir aus. Aber dann lassen sie einen Trupp Steineklopfer ran, die pulverisieren, was sogar Generationen von Grabräubern pietätvoll übersehen haben.«
Stammschröer stoppt in der Halle des Palazzo, vor dem Tor, und drückt Tolmeyn einen Umschlag in die Hand.
»Geld, Namen, Adressen sowie Don d’Ursos Aufsatz von 1842, zu Ihrer ersten Orientierung.«
Dann baut er sich vor Tolmeyn auf. Dass dieser glatt die Augen zusammenkneifen muss, so sehr gleißt die breite, weiße Hemdbrust in dem einen Strahl der Sonne, den die Toröffnung passieren lässt und in den der Professor sich platziert hat, als gebe es gar keinen anderen Ort für einen wie [27] ihn, als beanspruche er wie der gegenwärtige Kaiser seinen Platz an der Sonne. Er tippt Tolmeyn an die Schulter:
»Es sind die Gemahlinnen von Friedrich II. Falls sie es sind«, sagt er, »Friedrich zwo dem Staufer.«
Natürlich dieser Friedrich, denkt Tolmeyn, nur der hat Spuren in Unteritalien hinterlassen, und sagt: »Sie können sich wie stets auf mich verlassen, Herr Professor.«
Stammschröer nickt würdig, will nun abdrehen und hinauf in sein Direktorium. Aber er bremst sich: »Es wartet vielleicht noch eine andere Aufgabe auf Sie, Tolmeyn. Eine richtig große Aufgabe.«
»Ja?«, sagt Tolmeyn, für den Moment durchaus bedient. Er versucht interessiert, aber nicht allzu eilfertig zu klingen. Er muss doch erst einmal Andria auf der Landkarte finden.
Stammschröer schwankt, winkt ab.
»Na. Kommen Sie erst mal erfolgreich zurück. Dann werden wir sehen. Und: Denken Sie an Deutschland – und in großen Zusammenhängen.«
In seiner Unterkunft, nur ein paar Minuten vom Institut, packt Tolmeyn Wäsche, Hemden und Hosen, einen Zeichenblock, ein paar mehr oder weniger unverzichtbare kunsthistorische Bücher (um sich noch im Zug auf den Stand der Forschung zu bringen), Schreibsachen, ein kleines Hämmerchen, Meterstab, Winkelmaß, Taschenlampe, ein Klappmesser und was sonst noch in der Wildnis nützlich sein könnte. Ist das ein Malariagebiet? Er holt den Baedeker für Unteritalien aus dem Regal und faltet die beigefügte Karte aus. Andria, hier: unterhalb des Stiefelsporns, am südlichen Golf von Manfredonia, ein paar Kilometer landeinwärts. Das sieht [28] schon im bräunlich-gelben Kartenbild nach einer heißen und staubigen Gegend aus.
Dennoch: Endlich wieder hinaus. Kein Pergament mehr,...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.