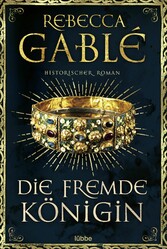Suchen und Finden
Garda, August 951
»Wenn Ihr leben wollt, müsst Ihr graben«, raunte der Mönch in dem ausgefransten, staubigen Habit.
Adelheid blickte nicht auf und ging weiter zur Kapelle, ohne ihren Schritt zu verlangsamen. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass der Mönch seinen Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzte – nicht hastig, nicht gemächlich, aber würdevoll, so wie Mönche eben gingen. Sie wusste trotzdem, dass dieser Mann nicht war, was er zu sein vorgab.
So wie alle Männer in ihrem Leben.
Die Morgensonne lugte bereits über die Burgmauer und ließ die staubige Erde hier und da wie Juwelen funkeln. Trotz der frühen Stunde herrschte schon reges Treiben im Innenhof: In der Schmiede auf der Nordseite sang der Hammer. Drei dienstfreie Wachen hatten sich an der offenen Tür versammelt und fachsimpelten mit dem Schmied. Mägde scharten sich um einen Eselskarren, der Brot, Kohlköpfe und fangfrischen Fisch aus dem Dorf heraufgebracht hatte. Alle wirkten geschäftig, aber jeder fand Zeit, der Gefangenen auf dem Weg zur Frühmesse einen kurzen Blick zu schenken. Manche waren mitfühlend, andere hämisch, die meisten undurchschaubar.
Adelheid betrat die dämmrige, schlichte Kapelle, während die beiden Wachen, die sie hergeleitet hatten, vor der Kirchentür Aufstellung nahmen. Stumm wie üblich, denn ihnen war wie allen Burgbewohnern verboten, das Wort an sie zu richten. Vater Giovanni stand bereits vor dem Altar und murmelte auf Latein vor sich hin, den Rücken zu der kleinen Gemeinde, die aus drei alten Weibern und einem blinden Mönch bestand.
Adelheid kniete sich in den buttergelben Sonnenfleck, der durch die Fensteröffnung über dem Altar auf den Boden fiel, und faltete die Hände. Die Sonne färbte die Dunkelheit vor ihren geschlossenen Lidern rötlich und wärmte ihr das Gesicht wie eine liebkosende Hand. Es war ein schönes Gefühl.
Heilige Jungfrau, voll der Gnaden. Heute ist der einhundertundneunzehnte Tag meiner Gefangenschaft, wie du zweifellos weißt. Seit fast vier Monaten bete ich zu dir, mich aus der Hand meiner Feinde zu befreien, aber es nützt nichts. Bruder Guido ermahnt mich, nicht den Glauben zu verlieren und mich darauf zu besinnen, dass ich eine burgundische Prinzessin und die Königin von Italien bin. Ich weiß, ich muss tapfer sein. Vor allem für Emma. Aber es wird von Tag zu Tag schwieriger. Heute früh beim Aufwachen habe ich mich dabei ertappt, dass ich keinen Funken Hoffnung mehr hatte. Und da kommt ein Fremder und sagt, ich solle graben. Hast du ihn mir geschickt? Bitte, heilige Muttergottes, lass mich an der richtigen Stelle graben. Und bitte, bitte lass es keine Falle sein …
»Wo haben sie Euch hingebracht?«, fragte Anna furchtsam, kaum dass die schwere Tür zu ihrem Kellerverlies mit dem vertrauten, hallenden Poltern zugefallen war.
»Zur Kapelle. Ich durfte die Frühmesse hören«, antwortete Adelheid.
»Gelobt sei Jesus Christus«, murmelte Bruder Guido. Er war nicht nur Benediktiner, sondern ebenso Priester und konnte somit selber die Messe feiern. Aber ohne Kirche, vor allem ohne Brot und Wein, fühlte es sich immer falsch an, wie gemogelt.
»Hier, die Wache hat unser Essen gebracht.« Die Magd wies auf den kleinen, wackeligen Tisch: ein Laib Brot und ein Krug Brunnenwasser. Das war alles, so wie jeden Tag. Für drei Erwachsene und ein Kind.
Adelheid nickte. Beim Anblick des mehlbestäubten Brotes sammelte sich zu viel Speichel in ihrem Mund, doch sie wusste, sie musste sich beherrschen und noch ein wenig warten. Wenn sie ihren Anteil schon jetzt am frühen Morgen anknabberte, würde sie wieder die ganze Nacht nicht schlafen können vor Hunger.
Sie kniete sich ins feuchte Bodenstroh und beugte sich über ihre schlummernde Tochter. Eine Fackel steckte in einem eisernen Wandhalter, und in ihrem Licht sah Adelheid die unnatürliche Blässe des Kindes. Emmas Geburtstag fiel auf den Tag des heiligen Cyprian im September, und falls sie ihn noch erlebte, würde es ihr dritter sein. Sie war immer zart gewesen. Selbst als Säugling hatte Emma nie Speck aufgewiesen; die älteren Hofdamen und Dienerinnen in Pavia hatten die Köpfe darüber geschüttelt. Aber jetzt war das Gesichtchen ausgezehrt, und unter den Augen lagen Schatten wie mit Holzkohle aufgemalt. Adelheid nahm Emmas kleine Hand in ihre und hauchte einen Kuss darauf. Fang ja nicht an zu heulen, schärfte sie sich ein. Das hilft niemandem.
Das Kind wurde nicht wach.
Adelheid richtete sich auf. »Ein Fremder in einer Mönchskutte hat mir auf dem Weg zur Kapelle zugeflüstert, ich solle graben«, berichtete sie Anna und Guido. Sie hielt die Stimme gesenkt. Sie war allein mit ihrer Magd und ihrem Kaplan, aber sie fürchtete immer, die Wachen könnten sie durch ein verstecktes Loch in der Mauer belauschen.
»Graben?«, wiederholte Anna, ebenso leise, aber unverkennbar ungläubig. »Durch Ziegel?«
»Aber was ist unter den Ziegeln?«, gab Adelheid zu bedenken.
»Fels«, antwortete der Bruder prompt. »Erinnert Euch an unsere Ankunft: Diese Burg thront auf einem Felsrücken über dem See.«
Adelheid nickte und streckte die Hand aus. »Gebt mir Euer Speisemesser, Bruder Guido.«
»Aber meine Königin, Ihr müsst doch einsehen, dass es keinen Zweck hat«, wandte er nachsichtig ein. Er war schmächtig, von eher kleinem Wuchs und mit einem sanftmütigen Wesen gesegnet, aber weil er hier der einzige Mann war, tat er gern so, als besitze nur er einen Funken Verstand. »Wir müssen uns in Geduld fassen und beten, dass Gott diese Prüfung bald vorübergehen lässt. Das ist das Einzige, was wir tun können.«
»Nur zu, betet, das kann keinesfalls schaden. Aber wenn wir nicht bald hier herauskommen, wird es für Emma zu spät sein. Also werde ich graben.«
Er löste das stumpfe, kurze Messer von der geflochtenen Kordel, die ihm als Gürtel diente, und legte es in ihre wartende Hand, warnte aber: »Wenn sie Euch erwischen, wird es furchtbar werden.«
»Ich weiß.«
Ihr Verlies lag tief in den Eingeweiden der Festung. Als die Gefangenen im Frühling hergebracht worden waren, hatten sie in der feuchten Kälte hier unten erbärmlich gefroren, aber inzwischen hatte die Sommerhitze, die draußen in der lebenden Welt das Gras verdorren ließ, den Keller ein wenig aufgewärmt. Der fensterlose Kerker war niedrig, maß jedoch acht mal zehn Schritte. Nicht wirklich genug Platz, um für einen männlichen und zwei – oder zweieinhalb – weibliche Gefangene den Anstand zu wahren, aber wenigstens hatten sie mit Hilfe einer Schnur und einer Decke eine Ecke abtrennen können, wo der Eimer stand, in den sie ihre Notdurft verrichten mussten. An der gegenüberliegenden Wand hatten sie ihre Schlafdecken ausgebreitet, nur für Emma gab es ein Schaffell. Der gesamte Boden war mit einer Strohschicht bedeckt, die halbwegs üppig und in vier Monaten immerhin einmal erneuert worden war. Den Blick nach unten gerichtet, schritt Adelheid langsam durch das Verlies, traf ihre Wahl willkürlich, sank etwa in der Raummitte auf die Knie und schob das Stroh beiseite. Die schmalen, roten Ziegel, die darunter zum Vorschein kamen, waren wie Fischgräten verlegt, schwärzlicher Lehm füllte die Fugen. Adelheid kratzte diese um drei der Ziegel vorsichtig mit Bruder Guidos Messer aus und wischte die Klinge gelegentlich im Stroh ab. Dann nahm sie den ersten Backstein zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände und ruckelte. Der längliche Ziegel löste sich anstandslos. Überrascht starrte Adelheid darauf hinab, legte ihn hastig beiseite und löste den nächsten. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie den Bodenbelag auf einer Fläche von sechs oder acht Handtellern gelöst.
Es raschelte, als Anna sich zu ihr ins Stroh hockte. »Und? Was ist unter den Ziegeln?«
»Schutt«, antwortete die junge Königin.
Bruder Guido hörte mitten im Credo auf zu beten und gesellte sich zu ihnen. »Und unter dem Schutt?«
Einen Moment sahen sie sich an, dann klaubten sie alle drei mit bloßen Händen das lose Material aus dem kleinen Erdloch. Zwei weitere Ziegel lösten sich vom Rand der Grabung. Der Schuttbelag bestand aus kleinen Kieseln und Gesteinssplittern, und die Schicht war vielleicht einen Spann tief. Darunter kam zu ihrer Verblüffung ein Eichenbrett zum Vorschein, und als sie auch das freigelegt und angehoben hatten, stieß Anna einen kleinen Schrei aus. »Heiliger Mauritius!«
»Was ist los?«, fragte Emma schlaftrunken.
Adelheid wandte sich zu ihr um. »Gar nichts.« Sie lächelte ihrer Tochter zu. »Alles ist gut, mein Liebling.«
Und vielleicht, vielleicht war das heute ausnahmsweise einmal keine Lüge.
Unter dem Holzbrett war der Fels, vor dem Guido sie gewarnt hatte, aber er formte ein so tiefes Loch, dass Emma sich darin hätte verstecken können. Und damit nicht genug, war der Fels porös. Als der Mönch das achtlos beiseitegelegte Messer zur Hand nahm und halbherzig damit an der Kante herumstocherte, bröckelte ein faustgroßes Stück heraus und kullerte abwärts. Adelheid steckte den Arm in das Loch, fischte den Brocken heraus und wog ihn in beiden Händen. »Leicht.«
»Aber selbst wenn der ganze Burgfels aus diesem porösen Stein besteht, brauchen wir Jahre, um uns ins Freie zu graben«, prophezeite der Mönch düster.
»Ich glaube nicht, Bruder Guido«, widersprach Adelheid versonnen.
»Wieso nicht?«
Ehe sie antworten konnte, hob Anna den Kopf. »Schritte!«
Adelheid sprang auf die Füße und schob hastig das Holzbrett zurück. Aber noch ehe Bruder Guido auch nur den ersten...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.