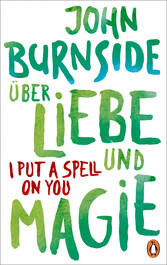Suchen und Finden
I Put a Spell on You
(Nina Simone, 1965)
Im Frühjahr 1958 zog meine Familie aus einem rattenverseuchten Mietshaus in der King Street in eines der letzten Fertighäuser in Cowdenbeath, das genau auf der Grenze zwischen dem vermüllten Wald an der Stenhouse Street auf der einen und dem kargen Ackerland auf der anderen Seite stand. In mancher Hinsicht war das für uns ein Aufstieg; die Fertighäuser hatte man während des Krieges zwar nur als vorläufige Unterkünfte gebaut, doch waren die klamme Kälte, die kittfarbigen Kondenswasserpfützen an Wintermorgen und die stickige Hitze an Augustnachmittagen für mein kindliches Gemüt kaum von Belang angesichts des Luxus, auf unserem eigenen Gartengrundstück zu leben, überdies in einem frei stehenden Gebäude nur wenige Meter von einem Hain hoher Buchen entfernt, in dem die ganze Nacht Waldkäuze jagten, deren wechselseitige Rufe so nahe klangen, als flögen sie direkt durch das winzige Schlafzimmer, das ich mit meiner Schwester teilte. Gleich hinter dem Hain lag Kirks Hühnerfarm, auf der die Tiere frei in weitläufigen Gehegen gehalten wurden; Mr. Kirk, der in einem Steinhaus wohnte, das mir wie ein altes Herrenhaus vorkam, eilte den ganzen Tag hin und her, brachte Futter, sammelte Eier ein und mistete die Ställe aus. Später, als ich alt genug war, durfte ich ihn begleiten und war stolz darauf, mit einem erwachsenen Mann Schritt zu halten, der seine Arbeit machte, Brutkästen prüfte und schwere Eimer voller Korn von hier nach da schleppte, all das mit einer Miene verhaltener Belustigung. Auf der anderen Seite von unserem Haus, jener zum offenen Land, wie ich gern dazu sagte, erstreckten sich in der einen Richtung Felder bis zum Waldstreifen, in der anderen das graue, egelverseuchte Wasser des Loch Fitty. So oft wie nur möglich stromerte ich draußen herum und bildete mir ein, ein Landkind zu sein, einer der Jungen aus meinen Bilderbüchern oder einer der Kumpane aus den Rupert-Jahrbüchern, von denen mir Tante Sall jedes Jahr eines zu Weihnachten schenkte.
Ich war erst drei Jahre alt, als wir in den Blackburn Drive zogen, aber es dauerte nicht lang, bis ich verstand, dass wir uns tatsächlich auf dem Weg »nach oben« befanden. Ich war sieben, als wir sogar einen Fernseher bekamen, und von da an durften Margaret und ich sonntags länger aufbleiben, obwohl wir am nächsten Tag zur Schule mussten, durften ein Eis von Katys Eiswagen lutschen und uns Sunday Night at the London Palladium ansehen. Mir ist schleierhaft, warum ich das jemals toll gefunden habe; für einen Siebenjährigen war die Show nicht besonders interessant, denn auch wenn gelegentlich Popstars auftraten, zeigte man doch meist bloß irgendwelchen Klamauk und dazu Tanzeinlagen. Bald wurde Sunday Night daher von Juke Box Jury verdrängt, einer Sendung, in der die neuesten Songs liefen und die aufgedonnerten Jurymitglieder mit ihren Beehive-Frisuren so schlank und gut aussahen wie meine Cousine Madeleine, nur nicht so schön.
Wenn Madeleine in unser Haus kam, meist an einem Samstagnachmittag, saß ich stundenlang am Küchentisch, während sie mit meiner Mutter schwatzte, und schaute fasziniert auf ihre langen, schlanken Finger und den kirschroten oder himmelblauen Lack auf ihren Nägeln. Jedes Mal sah sie anders aus – neue Nägel, neue Frisur, neues Kleid –, und doch blieb sie immer Madeleine. Schon als wir uns zum ersten Mal trafen, bei der Hochzeit einer anderen Cousine, hatte ich mich in sie verliebt – und bin es seither auf die eine oder andere Weise geblieben. Sie war zehn Jahre älter als ich und mit einem Matrosen der Handelsmarine namens Jackie verlobt, und sie war es auch, die mich begreifen ließ, dass die Love Songs, die ich bei Juke Box Jury hörte, tatsächlich etwas bedeuteten. Bis dahin hatte ich geglaubt, nur Worte zu hören, irgendwelches sinnloses, übertriebenes Gestammel, das wirklich niemand ernst nehmen konnte. Jetzt wusste ich es besser, denn jetzt war ich verliebt, und die Liebe fühlte sich seltsam an, so als erführe man die ersten Sätze einer Geschichte, deren Ende man niemals lesen würde, da dieses Ende jemand anderem gehörte.
Ich will jedoch gar nicht so tun, als wäre diese Schwärmerei je ein echtes Problem gewesen. Selbst mein neunjähriges Ich wusste, dass ich nur verknallt war; außerdem gab es damals so vieles auf jene leichte, jungenhafte Art zu lieben, von der ich glaube, dass die meisten Männer sich wünschen, sie würde ewig währen. Mit neun liebte ich fast alles und dies nahezu bedingungslos. Das stille Drama des ersten Schnees im Jahr. Dampfendes Tauwasser in den Gossen und Gräben. Der Bogen eines gut geworfenen Balls über den Sommerhimmel. Der abwesende Blick in Judy Garlands Augen, wenn die langweilige Handlung pausierte und sie den Mund öffnete, um zu singen. Die Kyries und die schwarzen Gewänder am Karfreitag. Der Hostienklecks auf meiner Zunge und die Hänseleien der Highschool-Mädchen, wenn ich über die Stenhouse Street und durch den Wald bei Kirks Hof nach Hause ging. Vor allem aber liebte ich die älteren Schwestern meiner Schulfreunde. Noch schlanke Mädchen, die dabei waren, sich in mehr oder minder schöne Frauen zu verwandeln, bislang unversehrt vom Ehestand, herrliche, freie Geschöpfe mit Geld in ihren Portemonnaies und einem süßen Lippenstiftlächeln für den gefühlsduseligen Jungen, der hin und wieder ihre Wege kreuzte. All das machte mich glücklich, und es kümmerte mich nicht, dass dieses Glück nur flüchtig war. Einige Minuten, eine Stunde, ein Septembernachmittag im Park – solche Augenblicke kamen, und dann waren sie vorüber, also blieben sie mysteriös und unbefleckt: eher ein Geschenk als eine Last.
Dann, an einem verregneten Samstagnachmittag, kurz nachdem Madeleine und Jackie geheiratet hatten, nahm meine Mutter mich mit, um die beiden in ihrer neuen Wohnung zu besuchen, und Madeleine spielte uns eine gerade gekaufte Platte vor. Es war »I Put a Spell on You« von Nina Simone, und in jenen zweieinhalb Minuten wurde mir klar, dass dies das Schönste war, was ich je gehört hatte. Alle verstummten, um zuzuhören, und als es vorbei war, saßen wir am Tisch, als hätte es uns die Sprache verschlagen, bis Jackie schließlich aufstand und sie noch einmal abspielte. Ich hatte den Song nie zuvor gehört, weshalb ich annahm, es sei die Originalversion, und dieser magische, wenn auch ein wenig traurige Nachmittag blieb mir jahrelang im Kopf, zusammen mit den Schnappschüssen von meiner Mutter und Madeleine im Pittencrieff Park, dazu der Klang von Janice Nicolls’ Stimme, die auf Thank Your Lucky Stars sagt: »Ich vergebe fünf Punkte«; Stränge im Webtuch meines Ichs, die dort reglos ruhten, aber wie die Kreaturen aus einem Horrorfilm der fünfziger Jahre nur einstweilen in der Schwarzen Lagune schliefen, jederzeit bereit, bei der leisesten Veränderung im Wetter oder in den Gezeiten wieder aufzuwachen.
*
Während des nächsten Jahrzehnts muss ich den Song viele Male in vielen verschiedenen Versionen gehört haben, in jenen Jahren also, in denen mein Vater mit großem Tamtam unsere Flucht aus Cowdenbeath plante, erst nach Australien, dann nach Kanada und schließlich zu meiner herben Enttäuschung nach Corby, indem er dort eine Stelle bei den Stahlwerken annahm. Corby war, dank des New Towns Act von 1946, zur Neuen Stadt erklärt worden, jenem Gesetz, das man erlassen hatte, um »Reißbrettorte« zu schaffen, die dann von den Großen und Mächtigen für das gemeine Volk regiert wurden4. Der Umzug in den Süden trennte meine Mutter von ihrer gesamten Familie und setzte den Besuchen meiner Cousine Madeleine ein Ende, doch beschwerte sich niemand, denn laut meinem Vater würden wir uns wieder einmal verbessern, bekämen ein richtiges Haus, kein Fertighaus, eine bessere Arbeit, bessere Schulen, überhaupt von allem das Bessere. Es musste besser sein, war das Ganze doch von Profis geplant worden, die wussten, was sie taten. Ich schätze, zumindest in dieser Hinsicht hatte er recht.
Corby war in jeder Hinsicht eine Enttäuschung, für meine Mutter aber fast eine Tragödie. Unser »besseres« Haus hatte drei Schlafzimmer, nur war die Küche kleiner als im alten Fertighaus, und wegen der klobigen Einbauschränke blieb kein Platz für einen Tisch. Trotzdem hielt meine Mutter sich wacker. Sie zog los, kaufte ein neues Transistorradio und stellte es aufs Fensterbrett, zu ihrer Unterhaltung, wie sie sagte, beim Backen und Kochen oder wenn sie draußen im Garten Goldlack pflanzte. Mein Vater hatte zudem einen neuen Fernseher gekauft, ein hässliches, sperriges Teil, das auf einem eigenen Tischchen in einer Ecke des mit Flockdruck tapezierten Wohnzimmers stand, von uns übrigen aber ignoriert wurde, weshalb auch das neue Haus bald wieder in die altbekannten Fraktionen zerfiel – Pferderennen und Fußballresultate in der Glotze einerseits, Sing Something Special und die neuen BBC-Sender andererseits. Folglich dürfte ich mit den Jahren mehrere Coverversionen von »I Put a Spell on You« gehört haben, nur achtete ich kaum darauf, bis sich ein Mädchen namens Annie an einem Samstagnachmittag im Charolais Café über die Rückenlehne ihres Sessels beugte und es mir ins Ohr sang, weißen Rum und Nescafé im Atem, das geschminkte Lächeln nur Zentimeter von meinem Gesicht entfernt, ihre Version weniger Nina Simone, eher ein Mix aus Credence Clearwater Revival und Arthur Brown, dazu vielleicht noch ein heiserer Hauch Janis Joplin. Wie auch immer, es war eine ziemlich scharfe Nummer.
Mich verblüffte, was passierte. Ich kannte Annie nicht besonders gut, obwohl sie mir oft aufgefallen war, wenn sie hereinkam, da sie immer lachte, sich immer bemüht und leicht hysterisch über alles...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.