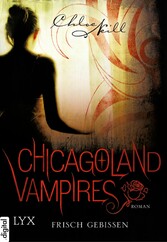Suchen und Finden
KAPITEL ZWEI
Reiche Menschen sind nicht netter –
sie haben einfach nur bessere Autos
Meine Eltern gehörten in Chicago zu den Neureichen.
Mein Großvater Chuck Merit hatte der Stadt vierunddreißig Jahre als Polizist gedient – er drehte seine Runden an der South Side, bis er zum Kriminalamt des Chicago Police Department wechselte. Er war eine Legende bei der Chicagoer Polizei.
Aber obwohl er seiner Familie eine solide, mittelständische Existenz ermöglichte, reichte das Einkommen manchmal nicht aus. Meine Großmutter stammte aus einer reichen Familie, aber sie hatte das Erbe ihres herrischen Vaters, der dem alten Chicagoer Geldadel angehörte, ausgeschlagen. Auch wenn es ihre Entscheidung war, so machte mein Vater es meinem Großvater zum Vorwurf, dass er nicht mit dem Standard aufwuchs, der ihm seiner Meinung nach zugestanden hätte. Geprägt von diesem angeblichen Verrat und verärgert über eine Kindheit in einem Haus mit Polizistengehalt, hatte mein Vater es sich zum Ziel gesetzt, so viel Geld wie möglich anzuhäufen, aber sonst gab es nicht viel in seinem Leben.
Aber Geld verdienen, das konnte er.
Merit Properties, die Immobilienfirma meines Vaters, verwaltete in der gesamten Stadt Wohnungs- und Hochhauskomplexe. Er war außerdem Mitglied des mächtigen Chicagoer Wirtschaftsrats, der sich aus Vertretern der in der Stadt ansässigen Unternehmen zusammensetzte und den gerade erst wiedergewählten Bürgermeister Seth Tate bei Planungsvorhaben und der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt beriet. Mein Vater war sehr stolz auf seine Beziehung zu Tate und ließ das auch oft genug im Gespräch fallen. Meiner Meinung nach warf das eher ein schlechtes Licht auf den Bürgermeister.
Natürlich hatte ich all die Vorteile genossen, die der Name Merit mit sich brachte – ein großes Haus, Sommercamps, Ballettunterricht, nette Klamotten. Aber wenn die finanziellen Vorteile auch beachtlich waren, so waren meine Eltern nicht gerade mitfühlende Menschen und mein Vater schon gar nicht. Joshua Merit wollte der Welt etwas hinterlassen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er wollte die perfekte Ehefrau, die perfekten Kinder und den perfekten Platz innerhalb der sozialen und finanziellen Elite Chicagos. Es war keine große Überraschung, dass ich meine Großeltern über alles vergötterte, denn sie wussten noch, was bedingungslose Liebe bedeutete.
Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass mein Vater meine neue Existenz als Vampirin besonders schätzen würde. Aber ich war ja schon ein großes Mädchen und sprang daher in mein Auto, nachdem ich mir die Tränen aus dem Gesicht gewaschen hatte – einen alten, kastenförmigen Volvo, den ich mir vom Mund abgespart hatte –, und fuhr zu ihrem Haus in Oak Park.
Als ich ankam, parkte ich den Volvo auf der Zufahrt, die in einem Bogen vor dem Haus verlief. Das Gebäude war eine gewaltige postmoderne Betonschachtel, die überhaupt nicht zu den viel dezenteren Häusern im Prairie-Style in der Nachbarschaft passte. Guter Geschmack ließ sich eben nicht mit Geld kaufen.
Ich ging zur Eingangstür. Sie wurde geöffnet, bevor ich klopfen konnte. Ich sah kurz hoch. Mürrisch dreinblickende graue Augen blickten auf mich aus einer Höhe von fast zwei Metern herab. Ein spindeldürrer weißer Typ stand vor mir. »Ms Merit.«
»Hallo, Peabody!«
»Pennebaker.«
»Das habe ich doch gesagt.« Natürlich kannte ich seinen Namen. Pennebaker, der Butler, war die erste große Errungenschaft meines Vaters gewesen. Was Kindererziehung betraf, hatte Pennebaker eine Mentalität, die sich nur mit »Wer an der Rute spart, verzieht das Kind« umschreiben ließ. Er war immer auf der Seite meines Vaters – er schnüffelte herum, verpetzte mich und ließ im Allgemeinen keine Gelegenheit aus, die saftigen Details meiner ach so rebellischen Kindheit weiterzugeben. Realistisch betrachtet lag ich, was Rebellionen anging, unter dem Durchschnitt, aber ich hatte perfekte Geschwister – meine ältere Schwester Charlotte war mit einem Kardiologen verheiratet und warf regelmäßig Kinder, und mein älterer Bruder Robert wurde darauf getrimmt, eines Tages das Familienunternehmen zu leiten. Da ich nur eine siebenundzwanzigjährige Doktorandin war, wenn auch an einer der besten Universitäten des Landes, war ich eben nur eine Merit zweiter Klasse. Und jetzt suchte ich unser trautes Heim wegen eines echten Knallers auf.
Ich ging hinein und spürte den Luftzug in meinem Rücken, als Pennebaker entschieden die Tür hinter mir schloss und dann vor mich trat.
»Ihre Eltern halten sich im vorderen Salon auf«, stimmte er an. »Sie werden erwartet. Sie waren über alle Maßen um Ihr Wohlergehen besorgt. Sie bekümmern Ihren Vater« – er schaute verächtlich herab – »mit diesen Dingen, in die Sie hineingeraten.«
Das nahm ich ihm übel, entschied mich aber, ihn nicht in seiner Annahme zu korrigieren, in welchem Maße ich meiner Wandlung zugestimmt hatte. Er hätte mir sowieso nicht geglaubt.
Ich ging an ihm vorbei den Flur entlang zum vorderen Salon und öffnete die Schiebetür. Meine Mutter, Meredith Merit, erhob sich von einem der extrem kastenförmigen Sofas im Raum. Selbst um dreiundzwanzig Uhr trug sie noch Stöckelschuhe, ein Leinenkleid und eine Perlenkette. Ihre blonden Haare saßen perfekt, ihre Augen waren blaßgrün.
Mom eilte mir mit ausgestreckten Armen entgegen. »Bist du in Ordnung?« Sie nahm mein Gesicht zwischen ihre Hände, deren Finger sehr lange Nägel hatten, und betrachtete mich von Kopf bis Fuß. »Bist du in Ordnung?«
Ich lächelte höflich. »Mir geht’s gut.« Aus ihrer Perspektive stimmte das sogar.
Mein Vater saß auf dem gegenüberliegenden Sofa. Er war genauso schlank und groß gewachsen wie ich, hatte dieselben kastanienbraunen Haare und blauen Augen und trug trotz der späten Stunde immer noch einen Anzug. Er blickte über den Rand seiner Lesebrille, eine Angewohnheit, die er sich glatt bei Helen abgeschaut haben könnte. Dieser Blick hinterließ nicht nur bei Menschen Eindruck, sondern auch bei Vampiren. Er schlug die Zeitung zusammen, die er gerade las, und legte sie neben sich auf das Sofa.
»Vampire?« Er schaffte es, das eine Wort sowohl wie eine Frage als auch eine Anklage klingen zu lassen.
»Ich wurde an der Uni angegriffen.«
Meine Mutter keuchte, griff sich mit der Hand ans Herz und warf einen Blick auf meinen Vater. »Joshua! An der Universität! Sie greifen Menschen an!«
Der Blick meines Vaters hatte sich nicht geändert, doch die Überraschung war an seinen Augen abzulesen. »Angegriffen?«
»Ich wurde von einem Vampir angegriffen, aber ein anderer hat mich dann verwandelt.« Ich erinnerte mich an die wenigen Worte, die ich mitbekommen hatte, an die Angst in der Stimme von Ethan Sullivans Begleiter. »Ich glaube, der erste flüchtete, weil er weggejagt wurde, und die zweiten hatten Angst, ich würde sterben.« Nicht ganz die Wahrheit – der Begleiter fürchtete, dass dies geschehen könnte; Sullivan war eindeutig davon überzeugt, dass es geschehen würde – und dass er mein Schicksal ändern könnte.
»Zwei Vampirgruppen? An der Universität von Chicago?«
Ich zuckte mit den Achseln, weil ich mir genau dieselbe Frage gestellt hatte.
Mein Vater schlug die Beine übereinander. »Und wo wir schon davon sprechen: Warum, in Gottes Namen, bist du mitten in der Nacht allein auf dem Universitätsgelände unterwegs?«
Etwas erwachte in mir. Vielleicht ein Funken Zorn, begleitet von einem Gefühl des Selbstmitleids – Emotionen, die ich beim Umgang mit meinem Vater mehr als einmal empfunden hatte. Normalerweise spielte ich aus Angst das Unschuldslamm; wenn ich die Stimme gegen meine Eltern erhob, riskierte ich, dass sie ihren seit Langem gehegten Wunsch nach einer anderen jüngsten Tochter äußerten.
»Ich habe gearbeitet.«
Sein Schnauben war als Antwort mehr als genug.
»Ich habe gearbeitet«, wiederholte ich, und in meiner Stimme lagen siebenundzwanzig Jahre Kampf um Selbstbehauptung. »Ich war auf dem Weg, einige Forschungsartikel abzuholen, und wurde angegriffen. Ich hatte keine Wahl, und es war auch nicht meine Schuld. Er hat mir fast die Kehle aufgeschlitzt.«
Mein Vater betrachtete die makellose Haut meines Halses und schien dies zu bezweifeln – Gott bewahre, eine Merit, eine Merit aus Chicago kann sich nicht allein verteidigen –, wechselte aber das Thema. »Und dieses Haus Cadogan. Sie sind alt, aber nicht so alt wie Navarre.«
Da ich Haus Cadogan bisher noch nicht erwähnt hatte, nahm ich an, dass derjenige, der meine Eltern angerufen hatte, sie auch über meine Verbindung zum Haus aufgeklärt hatte. Und mein Vater hatte sich anscheinend gründlich informiert.
»Ich weiß nicht viel über die Häuser«, gab ich zu und dachte, dass dies wohl mehr Mallorys Interessenfeld war.
Der Gesichtsausdruck meines Vaters ließ keinen Zweifel daran, dass ihn meine Antwort nicht überzeugte. »Ich bin erst heute Abend nach Hause gekommen«, sagte ich, um mich zu verteidigen. »Sie haben mich vor zwei Stunden vor meiner Haustür abgeliefert. Ich war mir nicht sicher, ob ihr es von irgendjemandem erfahren oder gedacht habt, ich sei verletzt oder so was, also bin ich vorbeigekommen.«
»Wir wurden angerufen«, lautete sein trockener Kommentar. »Vom Haus. Deine Mitbewohnerin …«
»Mallory«, unterbrach ich ihn. »Sie heißt Mallory.«
»… hat uns informiert, dass du nicht nach Hause gekommen bist. Dann rief das Haus an und ließ uns wissen, dass du angefallen worden...
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt.